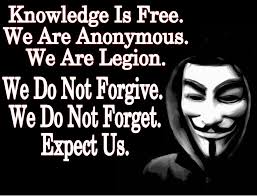17.08.2024, 20:03
Die Nesthäkchen und der Weltfrieden – Warum bringt Erziehung heute so wenige Erwachsene hervor
17 Aug. 2024
Wären es nur die Politiker, die die Weltsicht eines Kleinkinds haben, der Spuk wäre schnell vorüber. Aber was da geerntet wird, sind die Früchte einer Verschiebung in den Vorstellungen von Kindheit und Elternschaft, die überraschend wenige Erwachsene hervorbringt.
![[Bild: 66b367f148fbef4c111309be.jpg]](https://mf.b37mrtl.ru/deutsch/images/2024.08/article/66b367f148fbef4c111309be.jpg)
Spielende Kinder an einer Quelle; unbekannter Maler, Frankreich, 18. Jahrhundert - © AnonymousUnknown author (French artist), Public domain, via Wikimedia Commons
Von Dagmar Henn
Kennt noch jemand den Begriff "Nesthäkchen"? Damit wurde früher einmal das letztgeborene Kind einer längeren Geschwisterreihe benannt. Damit verband sich die Vorstellung von Unbeschwertheit, aber gleichzeitig einer gewissen dauerhaften Kindlichkeit, die aus diesem überbeschützten Zustand resultierte.
Heutzutage würde der Begriff gar keinen Sinn mehr machen, weil zumindest innerhalb der deutschen Gesellschaft fast nur noch Nesthäkchen entstehen. Reihenweise hat man bei führenden westlichen Politikern den Eindruck, sie hätten irgendwie das Erwachsenwerden verpasst, was womöglich für sie selbst ein glücklicher, für die Welt insgesamt jedoch ein verhängnisvoller Zustand ist.
Nur zwei Punkte zum Einstieg: Als meine älteste Tochter in die Schule kam, vor mittlerweile 30 Jahren, hieß es noch (und zwar allen Ernstes, das wurde bei der Schuleingangsuntersuchung abgefragt), ein Kind sei dann schulreif, wenn es den Weg zur Schule alleine zurücklegen könne. In den Jahren bis zur Einschulung meiner Zwillinge hatte sich das massiv geändert, obwohl nur 14 Jahre dazwischen lagen. Es wurde von den Eltern erwartet, die Kinder zur Schule zu bringen und sie abzuholen, und wenn sie alleine kamen, wurde das bereits missbilligend kommentiert. Dabei soll das in anderen europäischen Staaten inzwischen so weit gehen, dass Eltern verpflichtet sind, Kinder zur Schule zu bringen, solange sie noch keine zehn Jahre alt sind; auf deutsche Verhältnisse übersetzt, die gesamte Grundschulzeit.
Wenn man in meiner Schulzeit von den Eltern gebracht wurde, löste das noch eine Mischung aus Verachtung und Neugier aus; Verachtung, weil man damit wieder "klein" war, und Neugier, weil man doch irgendetwas angestellt haben musste, um so vorgeführt zu werden. Eine sehr weitgehende Veränderung in wenig mehr als einer Generation.
Es gibt noch einen weiteren Punkt, der in eine ähnliche Richtung geht. Der Bewegungsradius von Kindern ist immer weiter geschrumpft (darüber gibt es wissenschaftliche Studien), und sie bewegen sich selbst in ihrer nahen Umgebung immer später unabhängig. Natürlich sind diese Entwicklungen in den Städten ausgeprägter als auf dem Land und bei den Wohlhabenderen stärker als bei den Ärmeren. Aber die Vorstellungen, worin angemessene Fürsorge für Kinder besteht, setzen sich weit eher von oben nach unten durch denn von unten nach oben, und hier haben sich die Erwartungen sehr verschoben.
Dabei ist schon die Vorstellung der Kindheit selbst als eine auch außerhalb der Frage der sexuellen Reife vom Erwachsensein klar getrennten Lebensphase eine nicht allzu alte Entwicklung. Noch vor zweihundert Jahren, als 80 Prozent der Deutschen auf und vom Land lebten, waren Kinder schlicht jüngere Mitglieder der Produktionsgemeinschaft, und die ersten Ansätze von Schulpflicht stießen auf Widerstand, weil damit eine Arbeitskraft verloren ging. Viele der Vorstellungen, die man heute mit Kindheit verknüpft, vor allem die einer sehr langwierigen Unselbstständigkeit, sind das Ergebnis einer längeren Ausbildungsphase, die von Schulbeginn bis zum frühestmöglichen Zeitpunkt einer beendeten Lehre in Deutschland inzwischen mindestens elfeinhalb Jahre beträgt (neun Jahre Schulpflicht und eine verkürzte Lehrzeit von zweieinhalb Jahren). Alle anderen Ausbildungen dauern noch weit länger.
Der französische Historiker Philippe Ariès hat bereits im Jahr 1960 erforscht, wie sich die Idee der Kindheit in den europäischen Gesellschaften entwickelt hat. Wobei man derzeit fast den Eindruck hat, die Vorstellung des Behütetwerdenmüssens habe sich verselbstständigt und auch im stetig steigenden Anspruch an die Erziehungsleistungen der Eltern die Oberhand gewonnen, während Erziehungsziele wie Selbstständigkeit oder Konfliktfähigkeit und soziale Kompetenz deutlich in den Hintergrund treten.
Die Verluste, die dadurch entstehen, werden nicht wahrgenommen. Wenn in den Kindergärten die feste Gruppenstruktur aufgegeben wird, hat das womöglich seine Grundlage darin, dass die Personen, die die pädagogischen Vorstellungen in diesem Bereich formulieren, Gruppen schon nur noch unter Aufsicht von Erwachsenen erfahren haben und daher meinen, den Kindern damit einen Freiraum zu schaffen, während sie sie tatsächlich des letzten Raumes berauben, in dem eigenständige soziale Erfahrungen mit Gleichen möglich sind, denn Gruppen von Kindern, die unbeaufsichtigt durch die Gegend ziehen, gibt es nicht mehr. Zumindest nicht unter deutschen Kindern und Jugendlichen. Die vermeintliche Freiheit bleibt jedoch nach wie vor unter erwachsener Kontrolle, nur stabile soziale Kontakte werden unwahrscheinlicher. Und absurderweise wird genau die wichtige Erfahrung verringert, wie man sich nach einem Streit wieder versöhnt, weil es möglich ist, auszuweichen. Die Aufhebung von Gruppengrenzen macht auch die damit verbundenen Lernschritte unmöglich.
Und wie in der Erwachsenengesellschaft hat sich die Zahl der angebotenen Gruppen stark verringert. Sportvereine? Kinderchor? Die Anforderung der kontinuierlichen Betreuung ist auch ein Resultat der Erwartung, wenigstens das Gymnasium zu erreichen. Da darf es nicht zu viele Alternativen zum folgsamen Lernen geben. Und weil das ganze Bildungssystem auf Selektion und Konkurrenz beruht, ist das eine einsame Tätigkeit, keine gemeinsame.
Die Frage ist nur, wie das Ergebnis dieser Kindheitsvorstellungen aussieht, wenn auf der einen Seite Schritte zur Selbstständigkeit (wie die Bewältigung des Schulwegs) verteufelt und die Kinder so lang wie möglich von unabhängiger Fortbewegung abgehalten, aber andererseits sehr auf schulische Leistung orientiert werden. Woher soll dann beim resultierenden Erwachsenen das Gefühl für Verantwortung kommen? Und beschränkt sich die Sicht auf Verantwortung dann nicht auf ein Absolvieren vorgegebener Schritte, weil die Erfahrung, dass wirkliche Verantwortung auch in einem Freigeben bestehen kann, nie gemacht wurde?
Denken wir zurück an die Corona-Zeit. Die Schließung der Altenheime wurde von oben verordnet, und niemand hat dabei daran gedacht, zumindest jenen, die kognitiv entscheidungsfähig sind, die Entscheidung zu überlassen. Dass das eine Entmündigung war, haben zumindest die Fachleute danach zugegeben. Aber dass die Gesellschaft es hingenommen hat, dass die Kinder der unmittelbar Betroffenen es hingenommen haben, das ist die Folge der Verwechslung von Verantwortung und Kontrolle. Man ging mit den Alten um wie mit den Kindern.
Das Problem, das das Fehlen der Erfahrungen in unbeaufsichtigten Gruppen schafft und das sich weiter verschärft, wenn auch sonstige Gruppen fortfallen, ist, dass all die Momente verschwinden, in denen Verantwortung für bestimmte Abläufe und für andere Menschen eingeübt werden. Auch das ergibt sich nicht von allein. Aber es sind solche Erfahrungen, die lehren, dass die eigenen Kontrollmöglichkeiten in jedweder Umgebung beschränkt sind, und im günstigsten Falle lernt man sogar, dass es hilfreicher ist, die Entwicklung anderer zu fördern, statt sie zu beschränken.
Eltern, die ihre Kinder als Kleinkinder nicht aufs Klettergerüst lassen, haben sehr große Probleme, ihre Pubertät auszuhalten. Viel von diesem Kontrollbedürfnis ist ein Versuch, eigene Angst zu vermeiden. Natürlich macht man sich Sorgen, auch beim Klettergerüst. Und wenn sich Eltern früher weniger Sorgen machten, dann, weil sie weniger davon gesehen haben. Und natürlich ist man mittlerweile sehr schnell mit dem Vorwurf einer Vernachlässigung von Aufsichtspflicht bei der Hand; da verstärken sich die gesellschaftliche und die administrative Reaktion gegenseitig.
Aber kann man wirklich wollen, dass überdimensionierte Kleinkinder Entscheidungen über Leben und Tod treffen?
Es scheint ein Widerspruch, dass die gleichen Menschen, die im Zusammenhang mit Corona erklärten, die rigidesten Maßnahmen seien nötig, um Leben zu retten, nicht die mindesten Probleme zu haben scheinen, Hunderttausende auf ukrainischen Schlachtfeldern verbluten zu lassen. In Wirklichkeit entspringt beides einer Quelle – der Verdrängung oder vielleicht eher der fehlenden Wahrnehmung der eigenen Sterblichkeit. Was gleichzeitig beinhaltet, die allererste Grundlage menschlicher Gleichheit zu ignorieren: die Tatsache, dass jedes menschliche Leben, auch das eigene, endlich ist. Es ist das Ausweichen vor dieser Erkenntnis, die dieses eigenartige Schwanken zwischen Hysterie und Verleugnung auslöst.
Man kann das erkennen, wenn man die Formulierungen betrachtet, die Außenministerin Annalena Baerbock verwendet, um Ereignisse als in ihren Augen besonders schlimm zu kennzeichnen. Es geht immer darum, was sie "sehen musste". Ausgangspunkt ist immer sie selbst; schrecklich ist nicht, was anderen geschieht, sondern ihr Leid angesichts gewisser Bilder. Gerade weil das keine Empathie ist, sondern eher die Empörung darüber, an die Sterblichkeit erinnert zu werden, hört dieses Gefühl genau dort auf, wo sie sich selbst mit den Opfern nicht mehr identifiziert.
Genau das macht es erst möglich, ohne die mindesten Gewissensbisse bei einer Politik mitzuwirken, die so achtlos Menschenleben verschleudert, wie es zuletzt im Vietnamkrieg geschah. Wobei die damalige westliche Argumentation verglichen mit den heutigen Aussagen, die im Kern nicht mehr als ein "ich will das, also muss das so sein" sind, geradezu intellektuell war.
Auch wenn die Behauptungen sich auf Moral berufen, sind sie nicht moralisch, denn Moral ist nicht das, was man von anderen einfordert, sondern die Selbstbeschränkung, die man sich auferlegt. Das andere nennt sich Bigotterie. Daran ändert sich nichts, wenn man ein Dutzend Kränze mit Aufschriften wie "Weltrettung", "Klimaschutz" oder "Menschenrechte" darum hängt.
Womit man aber wieder bei den aufgeblasenen Dreijährigen wäre, und der Helikopterkindheit. Denn sowohl die Erfahrung der Begrenztheit der eigenen Möglichkeiten als auch der Notwendigkeit der Selbstbeschränkung sind nicht möglich, solange die Kontrolle in den Händen eines Erwachsenen liegt (hier meine ich erwachsen im rechtlichen, nicht im psychischen Sinn). Dass eigene Entscheidungen Folgen haben, kann niemand erkennen, solange eigene Entscheidungen verhindert werden. Das Freiheitsideal, dem im derzeitigen Westen gefolgt wird, orientiert sich aber nicht länger an einer erwachsenen Person, sondern tatsächlich an den Allmachtsfantasien eines Kleinkinds; denn die ganze Idealisierung von "Philanthropen" wäre nicht möglich, wenn nicht ein Zustand verantwortungsloser Macht als Wunschtraum und nicht als Schreckensbild gesehen würde.
Aber so günstig dieser infantilisierte Zustand für die Schaffung beliebig verführbarer Konsumenten und leicht lenkbarer Politiker ist, so verheerend ist er für das Funktionieren der Gesellschaft. Wenn alle nur bemüht sind, Verantwortung zu umgehen (das Ahrtal ist ein Paradebeispiel dafür), dann bricht das Fundament, weil keine größere menschliche Gruppe ohne wechselseitige Verantwortung funktioniert.
Wenn man noch einmal einen Blick auf Corona wirft, und auf das Gerede von den "kindlichen Virenschleudern" – eigentlich hätte das Wohl der Kinder den höheren Stellenwert haben müssen. Aber die Bedeutung von Kindern für die Gesellschaft wie für den Einzelnen ist untrennbar mit der Erkenntnis der Sterblichkeit verbunden, die wiederum ein Teil der psychischen Reife ist, die verzögert oder gar verhindert wird. Wodurch letztlich eine Erziehungsvorstellung, die Kinder nur noch als Individuen und nicht mehr als soziale Wesen sieht, dazu führt, die Kinder und ihre elementaren Bedürfnisse tatsächlich zu übergehen.
Die politisch sichtbaren Gestalten wie Baerbock, aber auch Bundeskanzler Olaf Scholz und der kanadische Premierminister Justin Trudeau, denen man gerne in einem Sandkasten ein Förmchen in die Hand drücken würde, sind nur das Symptom. Ein Symptom, das nicht möglich wäre, wäre nicht die Gesellschaft darunter zu guten Teilen im gleichen Zustand. Zumindest in Politik und Medien. Die lebenswichtige Frage ist nun, wie es kollektiv möglich ist, wieder erwachsen zu werden.
Mehr zum Thema -
Quelle:
"Wenn Unrecht Gesetz wird,wird Rebellion Pflicht."
Der Klartexter
Der Klartexter

 geht es um alles, was nicht rund läuft im Land
geht es um alles, was nicht rund läuft im Land



![[-] [-]](https://verkehrt.eu/images/collapse.png)