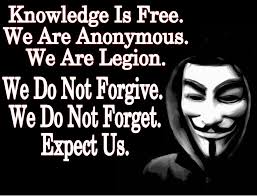12.09.2023, 18:34
Weidel und Deutschlands Niederlage – Eine Frage nationaler Würde
Kriegsende 1945
12. September 2023 - Karlheinz Weißmann
![[Bild: Titeloptik_JF_Online_Artikel_3_Kopie.jpeg]](https://assets.jungefreiheit.de/2023/09/Titeloptik_JF_Online_Artikel_3_Kopie.jpeg)
Die Debatte um die Äußerungen von Alice Weidel zur Niederlage Deutschlands im Zweiten Weltkrieg kocht hoch. Daß die Nachgeborenen heute die Deutlichkeit des Geschehens leugnen und es zu einer „Befreiung“ umdeuten wollen, hat oft mit Dummheit, meistens mit Verdrängung und immer mit dem Fehlen jedes Empfindens nationaler Würde zu tun. Ein Kommentar von Karlheinz Weißmann.
Da Alice Weidel eine kluge Frau ist, wird sie ihre Worte im Sommerinterview der ARD mit Bedacht gewählt haben. Gemeint sind die beiden Sätze, die erklärten, warum sie auf die Teilnahme an der Veranstaltung zum „Tag des Sieges“ in der russischen Botschaft verzichtet hat. Sie sei zu dem Entschluß gekommen, daß es nicht gehe, „die Niederlage des eigenen Landes … mit einer ehemaligen Besatzungsmacht“ zu feiern.
Die Reaktionen fielen wie erwartbar aus: eine einer Unbelehrbaren, die Revisionismus betreibe, Haß und Hetze säe und wenn nicht die Machtergreifung des neuen Faschismus vorbereite, dann doch den „geschichtspolitischen Grundkonsens“ in Frage stelle, der besage, daß der 8. Mai ein Tag der „Befreiung“, nicht der „Niederlage“ war. Den etwas klügeren Kommentatoren war immerhin bewußt, daß dieser „geschichtspolitische Grundkonsens“ weder Verfassungsrang besitzt noch seit je gegolten hat. Seine zentrale Stellung in der Dogmatik der geltenden Zivilreligion verdankt er vielmehr dem Verlauf der Kulturkämpfe, die während der 1980er Jahre ausgefochten wurden.
Deutschland war ein besiegter Feindstaat
Bis zu dem Zeitpunkt hätte an der Formulierung Alice Weidels kaum jemand Anstoß genommen. Denn von „Befreiung“ im Hinblick auf den 8. Mai 1945 redeten in der Regel nur Kommunisten und „heimatlose Linke“. Die Erlebnisgeneration pflegte dagegen ein gesundes Mißtrauen gegen jede Sprachregelung, die sich dem „Propagandamonopol“ (Konrad Adenauer) der Sieger verdankte, und die alliierte Direktive JCS 1067 – – mußte man gar nicht im Wortlaut kennen, um zu wissen, was der Einmarsch und die Besetzung des Reichsgebiets bedeutet hatten: zahllose Gewaltakte, die nie geahndet wurden, Gesetzlosigkeit, Plünderungen, Gefangenschaft der Soldaten, zum Teil unter katastrophalen Bedingungen, Festnahme und Internierung von Zivilisten. Vergewaltigungen gab es in Menge im französischen Besatzungsgebiet – nicht zuletzt durch Kolonialsoldaten –, in erheblicher Zahl in der US-Zone, hunderttausendfach im Osten. Unter sowjetischer Verantwortung kamen außerdem Massenmord, die Vertreibung von Millionen und Verschleppung hinzu, permanenter Terror und die Schaffung eines neuen Lagersystems auf der Basis des alten.
Bei aller Erleichterung, die die Deutschen über das Ende des NS-Regimes empfanden, wußten sie doch sehr genau, daß hier ein „Zusammenbruch“ (Kurt Schumacher) und sicher eine „Katastrophe“ (Friedrich Meinecke) stattgefunden hatte, die ursächlich mit der militärischen Niederlage der Wehrmacht zusammenhing. 1985, als aus Anlaß des 40. Jahrestags der Kapitulation mit großer Heftigkeit über die Bedeutung des 8. Mai gestritten wurde, hat Rudolf Augstein – der Gründer und Herausgeber des Spiegels, einst „Sturmgeschütz der Demokratie“ – diesen elementaren Sachverhalt noch einmal klargestellt.
Kohl machte einen Normandie-Rückzieher
In seinem Essay stehen aus Sicht der Gegenwart so skandalöse Aussagen wie die, es habe auf alliierter Seite „keine Kriegsziele“ gegeben, „außer dem einen, das Bismarck-Deutschland in Stücke zu zerschlagen“, oder daß nicht feststehe, daß „die Anti-Hitler-Verbündeten weniger Verbrechen begangen hatten als Hitler“, weshalb sie „nach den Maßstäben des späteren Nürnberger Prozesses allesamt hätten hängen müssen. Stalin zumindest für Katyn, wenn nicht überhaupt, Truman für die überflüssige Bombardierung von Nagasaki, wenn nicht schon von Hiroshima, und Churchill zumindest als Ober-Bomber von Dresden“. Entscheidend war aber die Folgerung, die Augstein zog: „Laßt sie feiern, weil sie den Krieg gewonnen haben. Wir gucken zu und feiern nicht mit, so wenig wie in der Normandie.“
Der letzte Halbsatz war ein Seitenhieb gegen den damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl, der im Vorjahr gerne an den Feiern der Sieger zum 40. Jahrestag der Invasion in der Normandie teilgenommen hätte. Allerdings machte er einen Rückzieher, auch weil der Widerstand in seiner Partei – der CDU – gegen eine derartige, als devot empfundene Geste massiver ausgefallen war als vermutet. Das waren aber schon Rückzugsgefechte des sogenannten „Stahlhelmflügels“, die Kräfteverhältnisse verschoben sich.
Weizsäcker-Rede als Zäsur
Unübersehbar wurde das, als der von der Union gestellte von der Vertreibung der Ostdeutschen als einer „erzwungenen Wanderschaft“ sprach, das deutsche Leid im Verhältnis zum Leid aller anderen einebnete und zuletzt festhielt: „Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung.“
Weizsäckers Ansprache bedeutete eine Zäsur, und zehn Jahre später durfte Kohl den 8. Mai endlich nach seinem Geschmack inszenieren. Zum Staatsakt waren deshalb hochrangige Vertreter aller ehemaligen Siegermächte geladen: der russische Ministerpräsident Wiktor Tschernomyrdin, der US-Vizepräsident Al Gore, der französische Präsident François Mitterrand und der britische Premier John Major. Sie alle betonten, wie wichtig es sei, den Blick nach vorn zu richten. Über die konkreten Umstände des Kriegsendes gingen Tschernomyrdin, Gore und Mitterrand mit Floskeln hinweg. Nicht so Major, für den der 8. Mai 1945 das Ende eines zweiten „Kriegs der dreißig Jahre“ markierte.
Moralische Begründungen wurden nachgeschoben
Mit dieser Formulierung griff Major auf die Formel zurück, die sein Vorgänger Churchill geprägt hatte, als er von einem „dreißigjährigen Krieg von 1914 an“ gesprochen und ausgedrückt hatte, daß die Friedensperiode zwischen 1919 und 1939 eigentlich nur eine Kampfpause in dem Konflikt war, der mit dem Ziel ausgetragen wurde, die „deutsche Gefahr“ zu beseitigen. Einer seiner Zeitgenossen, der amerikanische Diplomat George F. Kennan, hat die entsprechende Fixierung der Entente wie der Alliierten genau analysiert und als Ausdruck „einer hochgradigen politischen Hysterie“ bezeichnet.
Tatsächlich sei es Großbritannien, Frankreich, Rußland und den Vereinigten Staaten immer – während des Ersten wie des Zweiten Weltkriegs wie der Zwischenkriegszeit – um die Ausschaltung eines Konkurrenten gegangen. Moralische Begründungen habe man nachgeliefert, zwecks Dämonisierung des Feindes, um das eigene Gewissen (falls vorhanden) zu beruhigen und die Bevölkerung zu mobilisieren.
Da gibt es nichts zu feiern
Dem ist wenig hinzuzufügen: Die Alliierten führten Krieg gegen Deutschland aus denselben Motiven, die in der Geschichte immer wieder Anlaß zu Kriegen gegeben haben. Sie hatten zu keinem Zeitpunkt die Absicht, die Deutschen zu befreien, und – abgesehen von den Gegnern und Opfern des NS-Regimes – fühlten sich die Deutschen 1945 nicht befreit, bestenfalls „erlöst“ (Theodor Heuss) von einer Tyrannis und permanenter Todesgefahr, in jedem Fall aber besiegt.
Daß ihre Nachfahren die relative Uneindeutigkeit des Geschehens leugnen und es im Sinne einer „Befreiung“ zu vereindeutigen suchen, hat gelegentlich mit Dummheit, meistens mit Verdrängung und immer mit dem Fehlen jedes Empfindens nationaler Würde zu tun. Insofern muß man dankbar sein, wenn jemand daran erinnert, daß es angesichts der „Niederlage des eigenen Landes“ nichts zu feiern gibt.
Quelle:
"Wenn Unrecht Gesetz wird,wird Rebellion Pflicht."
Der Klartexter
Der Klartexter

 geht es um alles, was nicht rund läuft im Land
geht es um alles, was nicht rund läuft im Land



![[-] [-]](https://verkehrt.eu/images/collapse.png)